Straffrei ist nicht legal: Kommission zum Schwangerschaftsabbruch
Im März 2023 begann die Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin ihre Arbeit. Nun hat sie ihre Arbeit abgeschlossen und ihren Abschlussbericht an die Bundesminister:innen übergeben. Besonders die Empfehlungen zum Thema Schwangerschaftsabbruch sorgen seither für Schlagzeilen. Weiterlesen
Zugang zu sicheren Abtreibungen: EU-Kommission registriert Europäische Bürgerinitiative
Die Initiative „My Voice, My Choice: Für einen Zugang zu sicheren Abtreibungen“ fordert die Kommission auf, eine Maßnahme zur finanziellen Unterstützung für die Mitgliedstaaten vorzuschlagen, um sichere Schwangerschaftsabbrüche für jede Person in Europa zu ermöglichen, die keinen Zugang zu sicheren und legalen Abtreibungen hat. Weiterlesen
Endlich: Das Selbstbestimmungsgesetz ist da!
Am 12.04.2024 hat der Bundestag das lange erwartete Selbstbestimmungsgesetz verabschiedet. Damit können trans-, intergeschlechtliche* und nicht-binäre Menschen künftig ihren Personenstand durch Erklärung gegenüber dem Standesamt korrigieren lassen und sind nicht mehr auf langwierige, teure und demütigende Gerichts- und Begutachtungsverfahren angewiesen. Weiterlesen
Bundesministerin Paus und JFMK: Mehr Qualität in der Kindertagesbetreuung
Die Ministerinnen und Minister wollen die Qualität in der Kindertagesbetreuung gemeinsam weiter voranbringen. In einem „Letter of Intent“ würdigen sie den bisherigen Qualitätsprozess und verdeutlicht das gemeinsame Ziel, die Qualität der Kindertagesbetreuung weiterzuentwickeln und bundesweit anzugleichen. Weiterlesen
Welt-Roma-Tag: Ministerin Paus und Beauftragter Daimagüler für Vielfalt und Zugehörigkeit
Die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Lisa Paus, und der Beauftragte der Bundesregierung gegen Antiziganismus und für das Leben der Sinti und Roma in Deutschland, Dr. Mehmet Daimagüler, haben zum Internationalen Tag der Roma am 8. April auf die Situation der in Deutschland lebenden Roma aufmerksam gemacht. Weiterlesen



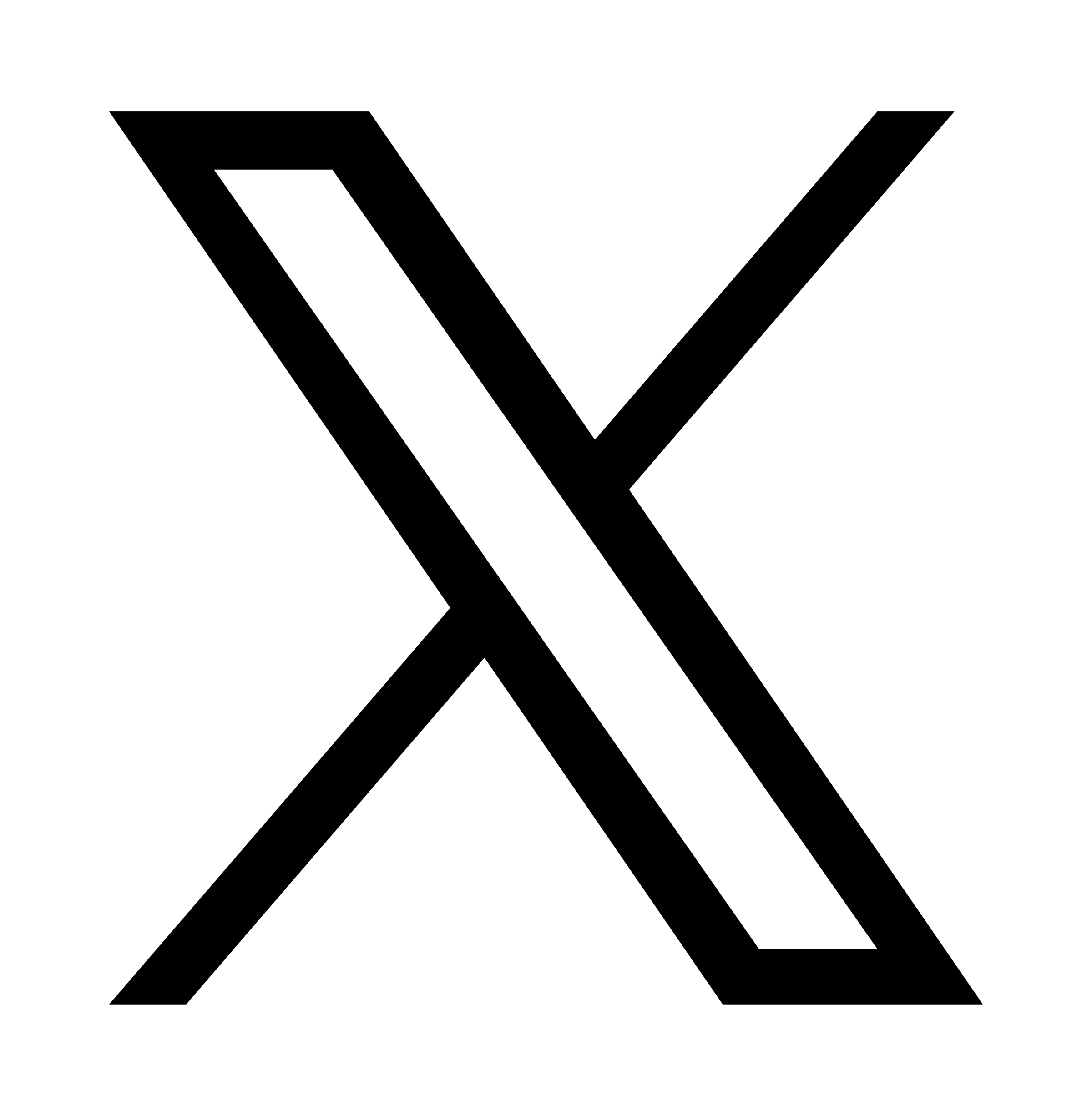 X
X
